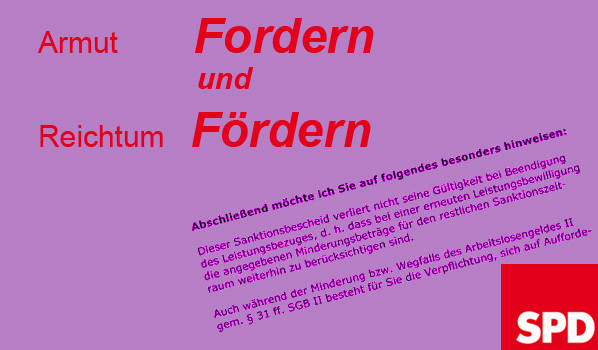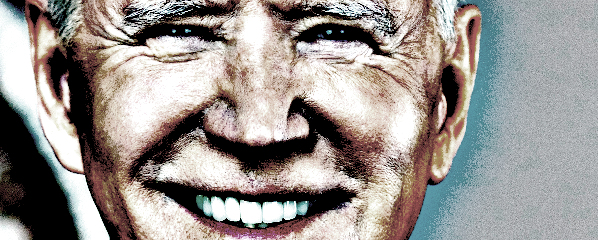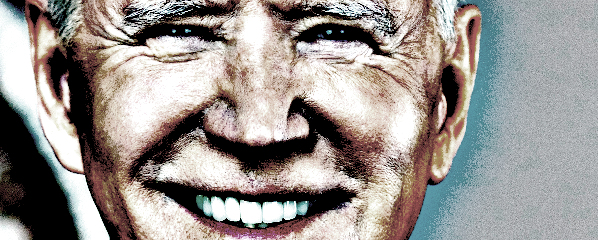
Die Polarisierung durch Moral steigert sich in der Massengesellschaft zur reinen Waffe. Da sie das Innen und Außen markiert, strikt zwischen zwei Werten entscheidet, deren Bestimmung durch keine Rationalität eingeschränkt ist, Emotionen schürt und spontane, unreflektierte Reaktionen hervorruft, macht sie das in einer durch hoch getaktete Massenmedien geprägte Kommunikation zu einem Instrument stetigen Pogroms. Die Verstärkung durch Medien, die Profite erzielen müssen und daher schon selbst auf das Erzählen von emotional aufgeladenen Geschichten angewiesen sind, tut ein Übriges.
Engt sich dann noch der Diskurs ein, indem eine Ideologie die Oberhand gewinnt, sinkt das Niveau der öffentlichen Kommunikation auf das eines aufgescheuchten Mobs auf der Suche nach Abweichlern. In Kriegszeiten kommen Wahrheit und Vernunft daher nicht zufällig zuerst unter die Räder, weil die vermeintliche Existenz eines Feindes alle diejenigen Projektionen loslässt, die älteste menschliche Hordeninstinkte ansprechen. Das da drüben ist dann das Monströse Übernatürliche, das im Gegensatz zu solchem göttlichen Ursprungs nicht besänftigt wird, sondern angegriffen und überwältigt werden kann: Der Feind.
Viel Feind, viel Teufel
Der Feind ist die Verschmelzung des Teufels mit denen, die nicht dazugehören. Das Feindschema fällt noch hinter die Kultur des Sündenbocks zurück, in der immerhin keine Menschenopfer mehr stattfinden. Krieg und Feindrecht bringen die Kultur als solche an den Rand ihrer Wirksamkeit. Vergewaltigen, plündern, foltern, morden sind dabei immer auch eine Erinnerung daran, dass die Subjekte in der Zivilisation Unterworfene sind und sich die sprichwörtlich entfesselten Triebenergien bei solchen Gelegenheiten eben entladen. Freud hat dazu in "Das Unbehagen in der Kultur" viel Richtiges gesagt.
Die Narrative der Kriegspropaganda sind nicht wirklich ein Extrembeispiel, sondern eher die Essenz des Einsatzes von – immer moralisch aufgeladenen – Narrativen in der öffentlichen Kommunikation. Emotionen bringen Einschaltquoten und Klickzahlen, und selbst völlig fiktionale Formate wie Liebesgeschichten werden mit moralischen Verstärkern ausgestattet. Man findet diese schon in den Kitschromanen vergangener Jahrhunderte, in denen der ehrbare Geliebte sich gegen den Schurken an der Seite der Liebsten bewähren muss, aber ebenso in mit vermeintlichen Tabus ausgeschmückten Geschichten 'verbotener' Liebe in Serien oder Filmen bis hin zur Pornographie.
Die Tragödie der Auserwählten
Moral ist spannend, geil und attraktiv. Sowohl der Verstoß als auch das Befolgen ihrer Regeln – und hier besonders der Einforderung gegenüber Dritten – erregen Aufmerksamkeit und binden den Rezipienten an die Geschichte. Spätestens seitdem "Storytelling" zu einem der, wenn nicht dem wichtigsten Element der Nachrichtenproduktion geworden ist, haben Narrative eine erhebliche Macht über die Gesellschaft.
Da in ihnen stets festgelegt ist, wer die Guten sind und wer die Bösen, haben sie in der modernen Massengesellschaft eine sehr ähnliche Funktion wie das antike Theater. Das geht quasi so weit, dass noch die lächerlichste Figur in Regierungsdiensten ernst genommen werden muss. Für die gekrönten Häupter ist die Tragödie das Medium. Für die niederen Chargen, und nur für sie, gibt es die Komödie.
Ein plapperndes Fräulein, das angesichts des drohenden Atomkriegs Hüpfspiele im Atombunker macht? Der 'mächtigste Mann der Welt', der als ersichtlich dementer, desorientierter Greis noch einmal für das Amt antritt? Darüber spricht man nicht, wenn es eben hohe Minister oder Präsidenten sind. Es sei denn, selbstverständlich, sie wären Feinde. Die sind grundsätzlich so lächerlich wie böse, brutal und verschlagen. Wenn man es recht bedenkt: So zivilisiert ist die Zivilisation nicht wirklich, und der moralische Kern ihrer überkommenen Struktur ist nicht zu leugnen.